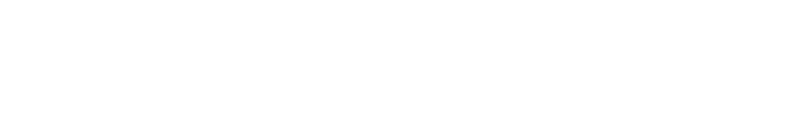Optimale Partnerwahl in der Hundezucht
Kurzvorschau: Die Partnerwahl in der Hundezucht ist weit mehr als nur das Verpaaren zweier Hunde. Sie ist eine bewusste Entscheidung, die die Zukunft einer Rasse nachhaltig prägt. Jede Wahl wirkt sich nicht nur auf den aktuellen Wurf aus, sondern beeinflusst langfristig die Gesundheit und die Eigenschaften der kommenden Generationen.
Den optimalen Zuchtpartner finden: Wie Züchter passende Paarungen auswählen
Bei der Auswahl eines Zuchtpartners spielen zahlreiche Faktoren eine Rolle. Das Wesen der Tiere, ihre körperliche Erscheinung und vor allem ihre Gesundheit. Das Wesen, der Charakter und das Verhalten werden nicht nur durch Gene, sondern vor allem auch durch Erziehung und Umwelt geprägt. Ein ausgeglichenes Temperament der Elterntiere erhöht die Chance auf sozial verträgliche Nachkommen. Wesenstests können von sachkundigen Zuchtrichtern durchgeführt werden und bieten eine objektive Einschätzung des Charakters eines Tieres.
Bei der Zucht wird seit langem auch besonders auf das äußere Erscheinungsbild eines Hundes geachtet. Körperbau, Fellfarbe, Schädelform oder Augenfarbe sind Merkmale, die einen Großteil der Rasseidentität ausmachen. Extreme Übertypisierung kann allerdings zu gesundheitlichen Einschränkungen, wie Atemproblemen, Gelenkfehlbildungen oder anderen ernsthaften Erkrankungen führen. Für fundierte Informationen und fachkundige Beratung ist der Zuchtclub der jeweiligen Rasse eine gute Anlaufstelle.
Die gründliche gesundheitliche Untersuchung der potenziellen Elterntiere durch den Tierarzt ist ein weiterer unverzichtbarer Bestandteil der verantwortungsvollen Hundezucht. Gelenk- und Herzuntersuchungen, Augenchecks, Röntgenaufnahmen und Gentests sind sinnvoll. Auch Untersuchungen auf Infektionen (z.B. auf das canine Herpesvierus CHV-1) spielen eine Rolle für die Gesundheit des Nachwuchses. All diese Maßnahmen helfen dabei, Krankheiten und Erbkrankheiten zu erkennen und deren Weitergabe zum Wohle der Nachkommen zu minimieren. Für einige erblich bedingte Erkrankungen gibt es noch keine Gentests, sodass betroffene Tiere nur durch tierärztliche Gesundheitschecks erkannt werden können.
Angesichts dieser Komplexität wird deutlich, dass die Genetik eine zentrale Rolle in der Hundezucht spielt. Während Umwelt und Erziehung wichtige Faktoren für das Verhalten und die Entwicklung eines Hundes sind, bestimmt die genetische Ausstattung maßgeblich Gesundheit, Wesen und viele körperliche Merkmale. Daher konzentriere ich mich im Weiteren auf die genetischen Grundlagen, die das Fundament jeder verantwortungsvollen Zucht bilden.

Erbkrankheiten verstehen: Warum genetische Tests unverzichtbar sind
Erbkrankheiten werden von Eltern an ihre Nachkommen weitergegeben und sind in der DNA verankert. Daher ist es für die Zucht extrem wichtig, die Genetik der Elterntiere zu verstehen und genetische Gesundheit als Grundlage für die Partnerwahl zu beachten.
Oftmals werden Erbkrankheiten rezessiv vererbt. Zum Ausbruch einer Krankheit kommt es hier erst dann, wenn beide Elternteile die veränderte genetische Variante an ihre Nachkommen vererben. Es ist häufig der Fall, dass Varianten unsichtbar von Generation zu Generation weitergegeben werden, bis sie durch eine ungünstige Partnerwahl – für den Züchter überraschend – zu kranken Welpen führen.
Das ist tragisch für die betroffenen Tiere aber vermeidbar, da die genetischen Testmöglichkeiten heutzutage vielfältig und günstig von unterschiedlichen Laboren angeboten werden. Für Zuchttiere empfiehlt es sich beide Elterntiere auf mindestens die in der Rasse bekannten Erbkrankheiten zu testen. Auch möglich sind breite genetische Screenings, in denen hunderte beim Hund bekannte Varianten untersucht werden und die über Rassegrenzen hinweg einen Überblick über die genetische Gesundheit eines Tieres bieten.
Hunde die eine rezessiv vererbte genetische Variante tragen, sollten nicht pauschal von der Zucht ausgeschlossen werden. Die genetische Vielfalt einer Rasse würde dadurch schnell verloren gehen, was andere Probleme, zum Beispiel erhöhte Krankheitsrisiken durch Inzucht, nach sich ziehen würde. Werden Trägertiere gezielt mit Tieren gepaart, die die Variante nicht in ihrer DNA tragen, entstehen keine von der Erkrankung betroffenen Nachkommen.
Für die Zucht ist das Wissen um den rezessiven Erbgang besonders bedeutsam. Durch gezielte genetische Tests kann festgestellt werden, ob ein Tier frei, Träger oder betroffen ist. Durch bewusste Partnerwahl eines frei getesteten Hundes für ein Trägertier, kann verhindert werden, dass die jeweilige Erbkrankheit in der nachfolgenden Generation auftritt, ohne dass der Träger komplett aus der Zucht ausgeschlossen werden muss. Auf diese Weise lassen sich sowohl das Wohl der Tiere sichern als auch die Gesundheit und genetische Vielfalt der Rasse langfristig erhalten.
Genetische Diversität: Warum Vielfalt die Grundlage langfristiger Gesundheit ist
In der verantwortungsvollen Hundezucht spielt die Vermeidung von Inzucht und der Erhalt von genetischer Diversität eine wichtige Rolle. Geschlossene Zuchtbücher und „popular sires“ (beliebte Deckrüden, die übermäßig häufig Väter einer Welpengeneration sind) erhöhen das Inzuchtrisiko. Damit verbunden ist ein Verlust von genetischer Diversität und Inzuchtdepression, d.h. die Verbreitung von schädlichen und krankmachenden genetischen Varianten. Bei der Auswahl von geeigneten Zuchtpartnern sollte also unter anderem auch darauf geachtet werden, dass die genetische Diversität einer Rasse gefördert wird. Hierfür bieten wir bei Labogen den Diversity Check an (beim Premium DNA-Profil Hund enthalten), der die genetische Ähnlichkeit potentieller Zuchttiere miteinander vergleichbar macht. (Mehr Infos zum Diversity Check finden Sie hier: https://labogen.com/genetische-diversitaet-hund/)
Weiterhin können auch Ahnentafeln für die Berechnung eines Inzuchtkoeffizienten (IK) herangezogen werden. Der IK ist ein Maß, der den Grad der Verwandtschaft zweier Hunde anhand der bekannten Vorfahren ausdrückt. Je kleiner der IK, desto weniger Inzucht. Für den genomischen Inzuchtkoeffizient (GIK), der die Verwandtschaft zweier Tiere direkt anhand ihrer DNA untersucht, sind wiederum genetische Tests die Voraussetzung.
Das größte Potenzial für eine nachhaltig positive Entwicklung einer Rasse liegt in der richtigen Balance zwischen Linienzucht und genetischer Offenheit.

DLA-Gene: Welche Bedeutung sie für das Immunsystem und die Zuchtplanung haben
Die sogenannten DLA-Gene (Dog Leukocyte Antigen) spielen eine wichtige Rolle im Immunsystem des Hundes. Eine hohe genetische Vielfalt in den DLA-Genen ist dabei von Vorteil für ein stabiles, funktionierendes Immunsystem. In vielen Hunderassen ist die Zahl der möglichen Haplotypen (feste Kombinationen der DLAs, die vom Elternteil an den Nachkommen weitergegeben werden) jedoch stark reduziert, da die selektive Zucht die genetische Vielfalt eingeschränkt hat. Faktoren wie eine geringe Anzahl an Zuchthunden, der häufige Einsatz von popular sires oder wiederholte Verpaarungen verwandter Tiere können die DLA-Diversität weiter verringern. In einigen Rassen wurde auch ein Zusammenhang zwischen bestimmten Allelkombinationen und dem Risiko für Autoimmunerkrankungen beschrieben. Ziel bei der Partnerwahl sollte daher sein, die DLA-Vielfalt innerhalb der Rasse zu erhalten oder zu steigern.
Farbgenetik: Welche Möglichkeiten und Risiken die Vielfalt der Fellfarben mit sich bringen
Fellfarben können in der Partnerwahl eine bedeutende Rolle spielen. Sie sind oft Teil von Rassestandards und bieten beeindruckende züchterische Möglichkeiten durch ihre Vielfalt und den großen Einfluss auf das äußere Erscheinungsbild. Hinter dieser Vielfalt stehen komplexe genetische Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Genen. Wer gezielt bestimmte Farbschläge erhalten möchte, sollte die genetischen Wechselwirkungen kennen und beachten. In den meisten Fällen sind Fellfarben an genetische Varianten gekoppelt, die nicht ursächlich für Erkrankungen sind. Ausnahmen finden sich z.B. bei der Weißscheckung (Piebald) und ihrer potenziellen Assoziation mit Taubheit, der Farbverdünnung (Dilution) die zum Teil mit der Farbmutantenalopezie (CDA) gemeinsam auftritt, dem Albinismus oder auch bei Merle. Das Merle-Gen (M) bewirkt eine Farbverdünnung, die interessante Muster aus unregelmäßigen Flecken auf aufgehelltem Untergrund erzeugt. Für die klassische Merle-Zeichnung, die auf dem heterozygoten Genotyp M/m basiert, sind keine gesundheitlichen Auswirkungen bekannt. Tragen Tiere das Merle-Gen allerdings reinerbig (homozygot), entstehen sogenannte „Weißtiger“ (Double Merle). Diese Tiere leiden oft an Einschränkungen der Seh- und Hörorgane bis hin zu Blind- und Taubheit. In Deutschland ist die Zucht von Double Merle verboten. Für die Partnerwahl empfiehlt sich in jedem Fall ein Gentest der potentiellen Elterntiere, um das Entstehen von Double Merle sicher ausschließen zu können.
Erfolgreich züchten: Wie fundiertes Wissen zu verantwortungsvoller Hundezucht führt
Bei so vielen zu beachtenden Aspekten und Einflüssen kann die Freude an der Zucht manchmal ins Wanken geraten. Doch keine Sorge, Unterstützung finden Sie bei Tierärzten, Zuchtvereinen, genetischen Laboren und Züchterkollegen! Die Kombination aus Fachwissen, Beobachtungsgabe und genetischen Testergebnissen bildet die perfekte Grundlage für eine erfolgreiche Partnerwahl. Lernen Sie von erfahrenen Züchtern, nehmen Sie an Fortbildungen teil, wie zum Beispiel dem Züchtertag von Laboklin oder hören Sie die speziell zugeschnittenen Vorträge des VDH. Unterschätzen Sie nie den Wert des Austauschs und der Vernetzung innerhalb der Züchtergemeinschaft, auch auf internationaler Ebene.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Erfolg und die optimale Partnerwahl in der Hundezucht aus dem Zusammenspiel vieler wichtiger Faktoren entstehen. Gesundheit und Wesen stehen hier besonders zentral im Fokus. Es geht nicht darum, aktuellen Trends nachzueifern oder extreme Zuchtziele zu verfolgen, sondern vielmehr darum, die langfristige Gesundheit und das Wohl der Rasse zu sichern. Jeder verantwortungsbewusste Züchter trägt dazu bei, die Zukunft sowohl für die eigenen Welpen als auch für kommende Generationen gesund und stabil zu gestalten.
Dr. Anna-Lena Van de Weyer
INFOBOX 1
Zusammenfassung
- Gentests: Prüfen Sie alle rassespezifischen Erbkrankheiten
- Trägertiere: Schließen Sie diese nicht aus, sondern verpaaren Sie diese mit freien Tieren
- Diversität: Fördern Sie die genetische Diversität um Inzuchtfolgen zu vermeiden
- DLA-Gene: Erhalten Sie Vielfalt und vermeiden Sie Risiken für das Immunsystem
INFOBOX 2
Tipps für die Informationsbeschaffung
- Suchen Sie aktiv den Austausch mit erfahrenen Züchtern und lernen Sie aus deren Praxis.
- Nutzen Sie Beratungen durch Zuchtvereine, Tierärzte und genetische Labore für fundierte Entscheidungen.
- Nehmen Sie an Fortbildungen, Seminaren und Fachvorträgen teil, um Ihr Wissen aktuell zu halten.
- Dokumentieren Sie Tests, Ergebnisse und Zuchtentscheidungen sorgfältig, um Transparenz und Nachvollziehbarkeit zu sichern.